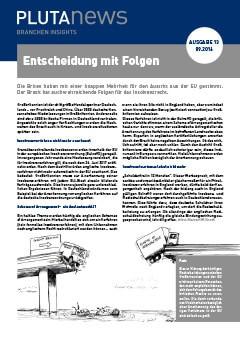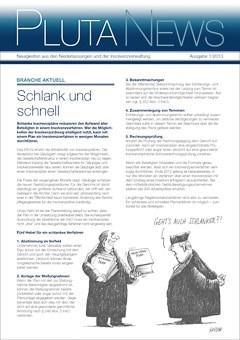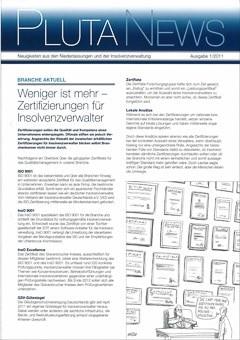Erlösrückgänge, steigende Kosten und die geplante Krankenhausreform setzen viele kommunale Kliniken unter Druck. Die Geschäftsführer müssen frühzeitig handeln.
Die wirtschaftliche Lage vieler kommunaler Krankenhäuser hat sich zugespitzt. Rückläufige Umsätze sowie steigende Energie- und Personalkosten führen dazu, dass zahlreiche Einrichtungen rote Zahlen schreiben. Zudem belastet der Fachkräftemangel und strukturelle Anpassungen infolge des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) sind notwendig. Träger und Geschäftsführer sehen sich daher zunehmend mit der Frage konfrontiert, wie die medizinische Versorgung vor Ort aufrechterhalten werden kann, ohne dabei gegen insolvenzrechtliche Pflichten zu verstoßen oder die kommunalen Haushalte zu überfordern.
Die wirtschaftliche Stabilisierung kommunaler Krankenhäuser in Zeiten klammer Kassen ist eine Herausforderung. Maßgeblich ist dabei stets die rechtliche Ausgestaltung der Einrichtung. Sofern das Krankenhaus in privatrechtlicher Form, also etwa als gGmbH, betrieben wird, unterliegt es uneingeschränkt den Vorschriften der deutschen Insolvenzordnung. Dies umfasst auch die einschlägigen Haftungsnormen, insbesondere für Geschäftsführung und Aufsichtsgremien.
Ertrags- und Liquiditätsplanung
Um Haftungsrisiken zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass eine Durchfinanzierung über einen Zeitraum von mindestens 12 bis 24 Monaten gewährleistet ist. Hierfür bedarf es einer fortlaufenden monatlichen Ertrags- und Liquiditätsplanung. Kapitalzusagen des Gesellschafters sind nur dann insolvenzrechtlich tragfähig, wenn diese den Anforderungen an verbindliche Finanzierungszusagen entsprechen, also in Form einer „harten“ Patronatserklärung oder einer Finanzierungszusage, die sowohl der Höhe nach als auch in Bezug auf die Zeitpunkte der Mittelzuflüsse bestimmt ist. Zudem müssen diese Zusagen durch die erforderlichen Gremienbeschlüsse sowie durch entsprechende Haushaltsansätze gedeckt sein.
Gesetzliche Vorgaben und Reformen
Ein weiterer zentraler Faktor ist die Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG). Die angestoßene Reform war im vergangenen Jahr beschlossen worden, um die deutsche Krankenhauslandschaft finanziell zukunftsfest zu machen. Die Reform sieht unter anderem eine stärkere Spezialisierung der Kliniken und in Teilen eine Abkehr von der Finanzierung über Fallpauschalen vor. Ziel ist es, die Behandlungsqualität zu verbessern und ein unkontrolliertes Kliniksterben zu verhindern.
Die Bundesregierung setzt nun Änderungen an der Reform um. Die Bundesländer erhalten mehr Zeit, um die Reform umzusetzen. Zudem sind weitreichende Ausnahmeregelungen vorgesehen. An den Grundprinzipien wird jedoch festgehalten: Nicht jede Klinik soll jede Leistung anbieten. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Entwurf des Krankenhausreformanpassungsgesetzes (KHAG) im August vorgelegt; im Oktober hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf beschlossen.
Auswirkungen und Anpassungen
Das neue Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten, aber die Reform hat bereits heute deutliche Auswirkungen auf die tägliche Arbeit bei der Sanierung von Krankenhäusern.
Notwendige Strukturanpassungen, etwa die Schließung oder Verlagerung von Standorten, die Reduzierung von Personal- oder Sachkosten oder die Einschränkung bestimmter Leistungsgruppen, müssen frühzeitig eingeplant und in die Finanzplanung integriert werden. Dabei ist zu prüfen, welche Leistungsgruppen auch künftig noch erbracht werden dürfen und welche spezifischen Anforderungen hierfür gelten.
Darüber hinaus sollten Verbundlösungen mit benachbarten Krankenhäusern in Betracht gezogen werden. Solche Kooperationen können positive Effekte im Hinblick auf Fort- und Weiterbildung, die regionale Abstimmung von Leistungsgruppen, die Patientensteuerung sowie die Ausbildung von Pflegepersonal entfalten.
· Dr. Maximilian Pluta