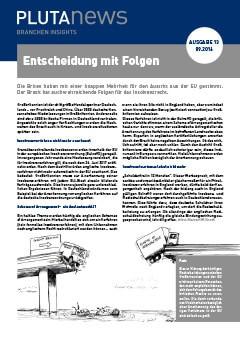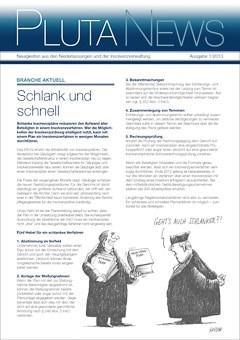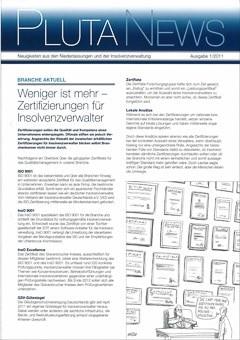Die Rückzahlung der Corona-Hilfen stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Bei den Schlussabrechnungen lauern Risiken. Fehlen die finanziellen Mittel, müssen Lösungsansätze ermittelt werden.
Soforthilfe, Überbrückungshilfen I-IV, Neustarthilfe (Plus/2022), November-, Dezember- und Härtefallhilfen - diese Begriffe sind seit mehr als zwei Jahren allgegenwärtig. Im Juni 2022 liefen die letzten Corona-Hilfen aus. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen: Rund 5 Mio. Anträge auf Zuschüsse sowie 170.000 Anträge auf Kredite wurden gestellt, rund 130 Mrd. Euro hat der Staat daraufhin in Form von Zuschüssen (71,3 Mrd.) und Krediten (58,8 Mrd.) gewährt.
Nach Beendigung dieser Förderpakete erhalten Unternehmer derzeit vermehrt Aufforderungen zur Rückzahlung, die sie vor große Herausforderungen stellen. Wir erklären, wer von der Rückzahlungsverpflichtung betroffen ist, und welche Konsequenzen daraus entstehen können.
Wer muss Hilfen zurückzahlen?
Zur Rückzahlung sind all diejenigen verpflichtet, die einen höheren Vorschuss vom Staat erhalten haben als ihnen letztlich zusteht. Grund ist, dass die zu Beginn der Pandemie gestellten Anträge auf Umsatz- und Kostenprognosen für den Pandemiezeitraum basierten. Bis zum 31.12.2022 ist nach (Teil-)Bewilligung von coronabedingten Unterstützungsmaßnahmen eine sogenannte End- bzw. Schlussabrechnung durch die geförderten Unternehmen zu erstellen. Dabei ist der tatsächliche Umsatz mit dem prognostizierten Umsatz zu vergleichen. Fällt der tatsächliche Umsatz höher aus als bei Antragstellung kalkuliert, ist die Differenz der staatlichen Förderung zurückzuzahlen.
Vollständige und richtige Angaben machen
Die Schlussabrechnungen sind also Grundlage des ermittelten Rückzahlungsbetrages. Hier können insbesondere unvollständige oder fehlerhafte Angaben bei der Antragstellung korrigiert werden. Sollte diese Abrechnung bis zum Ablauf der jeweiligen Frist nicht erfolgen, droht die Rückzahlung des gesamten Förderungsbetrags unter Aufhebung des Bewilligungsbescheids.
Unternehmen und Selbstständige müssen daher unbedingt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben achten. Schon bei leichtfertigen Falschangaben kann nämlich ein strafbarer Subventionsbetrug vorliegen.
Im besten Fall wurden bereits bei Antragstellung konservative Prognosen zugrunde gelegt, um hohe Rückzahlungsforderungen zu vermeiden. Gut zu wissen: In der Bilanz sind dazu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.
Nach Zustellung der Rücknahmebescheide gilt es, die Rechtmäßigkeit des Bescheides zu überprüfen. Hier ist aufgrund laufender Fristen, Dauer ein Monat, schnelles Handeln erforderlich.
Was tun, wenn hohe Rückzahlungen zu leisten sind?
Bei finanziellen Schwierigkeiten ist es möglich, Stundungs- oder Ratenvereinbarungen mit dem jeweiligen Rückzahlungsempfänger abzuschließen. Um die Vereinbarungen rechtzeitig vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfristen zu erreichen, müssen diese kurzfristig verhandelt werden. Sind die Zahlungen für den Unternehmer in keinem Fall leistbar, ist ebenso rasches Handeln notwendig. Restrukturierungsmaßnahmen nach dem StaRUG oder Sanierungslösungen nach der InsO sind dabei in die Überlegungen unbedingt einzubeziehen.
· Kristina Breuer und Philip Konen, PLUTA Niederlassung Frankfurt